Wenn die Gartenidylle zur Zumutung wird …
Mit Lupe und sprachlicher Präzision seziert Bernhard Strobel
das diffuse Geflecht menschlicher Beziehungen.
„Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in einem solchen Gespräch vorkamen, in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich einmal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Blachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen und ihren Handlungen.“ (Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänden, Bd.2, S. 342)
Dieses Bild, mit dem Lord Chandos seine Krise zu fassen sucht, hat Literaturgeschichte geschrieben; knapp 115 Jahre später könnte man meinen, Bernhard Strobel habe seinem Erzählband „Ein dünner Faden“ den Satz Hofmannsthals zugrunde gelegt. Sieben der neun Erzählungen skizzieren eine Idylle: Wohlstand, Haus, Garten, Pool – kurz: Voraussetzungen für ein Leben, das glücken sollte, und doch: Beinahe gesetzmäßig zieht sich „ein unsauberer Schnitt durch das makellose Bild“ (S. 28).
Illusions- und schonungslos führt Bernhard Strobel unter dem Vergrößerungsglas sein Seziermesser; und was zutage tritt, beunruhigt, mehr noch, irritiert, weil es geradewegs zur Selbstbefragung führt.
„Alles ist bestens“ – so der Titel der ersten Erzählung, bezeichnend für die Idylle, die Bettina und den Ich-Erzähler umgibt:
„Ich stand am Schlafzimmerfenster und schaute hinunter auf die Straße, Bettina war im Garten und deckte den Swimmingpool ab, richtete Liegestühle und Handtücher her und brachte ein großes Frühstück hinaus zum Tisch. Sie fühle sich wie im Urlaub auf einer griechischen Insel, hatte sie am Morgen zu mir gesagt.“ (S. 5)
Die beiden kennen einander sehr gut, wissen nach 14 Jahren die Körpersprache und Worte des anderen zu deuten, und dennoch: Hinter der Fassade lauert eine irritierend diffuse Spannung, werden abgründige Einstellungen sichtbar:
„Ich entgegnete, dass die Fähigkeit zu lügen den Menschen erst zu dem mache, was er ist, und dass in der Möglichkeit zur Unwahrheit ein großer Teil seiner Freiheit begründet liege und jedermann das Recht habe zu lügen, insbesondere wenn die Wahrheit einem selbst schaden würde oder jemandem, der einem nahe steht.“ (S. 18)
Ausgelöst von einem eher routinemäßigen Besuch einer Polizeistreife setzt ein misstrauisches Spiel ein, ein subtil geführter Zweikampf, der zu einem beklemmenden Ende führt:
„Du traust mir doch keine Brandstiftung zu?
Sie schüttelte den Kopf.
Aber irgendetwas traust du mir zu?
Ich blickte sie an, wartete, was noch kommen würde. Aber es kam nichts. Sie lehnte sich zurück. Ich verstand, dass es ihr lieber war, nicht darüber zu reden.“ (S. 20)
Wie eine Idylle unter dem prüfenden Blick durch ein Vergrößerungsglas zerbricht, das macht Bernhard Strobel zum bestimmenden Thema seiner Erzählungen. In stets neuen Variationen demonstriert er, wie dünn und brüchig Beziehungen oft sind, die auf den ersten Blick stabil und harmonisch erscheinen: Da wird beobachtet, gegenseitig belauert, gespielt, taktiert, getrickst und gelogen; da ist von „Misstrauen“ und „Waffen“ die Rede, sogar von „Genugtuung“, wenn der andere mit dem Rücken zur Wand steht; da geht es darum, gegen die Partnerin „etwas Handfestes“ (S. 21) ins Treffen führen zu können; da bestimmen weitgehend Phantasien die Kommunikation, die vor allem ein Ziel zu haben scheint: in einem Zweikampf die Oberhand zu gewinnen.
Das alles ist motivisch kunstvoll verwoben: Überzeugend, aber stets unaufdringlich evoziert der Schauplatz Garten samt Terrasse immer wieder biblische Assoziationen. In jener Geschichte, in der das blanke Ausleben von Launen alles zerbricht, erlebt der Vater der dreiköpfigen Familie „den Anblick des schönen Gartens, der eingezäunten Idylle wie eine Zumutung“ (S. 100). In seiner emotionalen Extremsituation bleibt ihm nur eine Lösung: Mit Fußtritten und Rechen das Paradies seines Gartens zu verwüsten – ein bedrückendes Kammerspiel über den Auszug aus dem Garten Eden.
Kontrastiv gestaltet ist immer auch die Atmosphäre:
„Es war nahezu windstill.“ (S. 5)
„Der Himmel war wolkenlos, es gab keinen Wind, die Stille war absolut.“ (S. 23)
„Es herrschte nicht die geringste Bewegung in der Luft.“ (S. 77)
In diese aufgeladene, sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm setzt Bernhard Strobel seine Figuren, die „nicht wissen, wohin mit sich“ (S. 22), in denen „ein Hin und Her an Gefühlen tobt“ (S. 49). In der Folge beobachtet er akribisch, wie sie mit all den Spannungen, denen sie ausgesetzt sind, zurechtkommen. Und dabei bleibt vieles in Schwebe. Virtuos zieht der Autor die Register der feinen Andeutung, vertraut darauf, dass seine nüchternen Beobachtungen all das in den Köpfen der Lesenden auslösen, was es zu zeigen gilt, beispielsweise die erotische Anziehung, die in der Erzählung „Die Amseln“ zwischen Lukas und Andrea, der Freundin seiner Frau Marianne, schwelt, aber vor dieser natürlich verborgen bleiben muss:
„Nach wenigen Minuten kehrte er zurück und sah Andrea mit einer Handvoll Tomaten im Gemüsebeet stehen. Er ließ sich Zeit, um sie länger ansehen zu können, auch ihre nackten Füße betrachtete er, die leicht in den feuchten Boden eingesunken waren, die lose Erde zwischen ihren kleinen Zehen. Er trat neben sie ins Beet. Als er ihr die Schale reichte, fiel sein Blick auf das Haus und er konnte sehen, wie Mariannes Kopf hinter der Wand neben der Terrassentür verschwand.“ (S. 27)
Die Anordnung der Texte folgt einem dramaturgisch klugen Plan: Nach sechs Variationen über das Zerbrechen einer Idylle gestaltet die Erzählung „Leider, leider“ eindringlich die Sehnsucht zweier Menschen nach Beziehung, bevor im „Schattentheater“ – dem desillusionierenden Schlussakkord der Variationen – der Ich-Erzähler „sorgfältig und ruhig die Pflanzen zerstört, die er selbst erst vor kurzem eingesetzt hatte“ (S. 100). Und dann, im neunten und letzten Text, taucht es auf, das eingangs erwähnte Vergrößerungsglas des Lord Chandos: Als Fernglas trägt es ein an einen Rollstuhl gefesselter Briefeschreiber an einer Schlaufe um den Hals, um jederzeit in der Lage zu sein, aus dem fünften Stock eines Krankenhauses „durch ein kleines Fenster einen Blick hinauszuwerfen in die Welt“ (S. 103). In sieben Briefen an seinen Freund K. räsoniert W. über Gott und die Welt und offenbart dabei ein lustvoll zynisches Resümee seines Lebens: Einsam, glücklos, bindungsunfähig und grotesk misanthropisch wird er auf dem Sterbebett sagen: „Das ist alles, mehr kommt nicht.“ (S. 123)
Konsequent in Schwebe gehalten auch dieser Text: Das Fernglas und die durch Werther und Kafka aufgeladenen Initialen W. und K. führen sehr bald schon dazu, in dieser skurrilen, mitunter kafkaesk anmutenden Brieferzählung ein literarisches Suchbild zu sehen, das unter anderem den Kreis zu Hofmannsthals „Brief“ schließt:
„Die Sprache. Sie ist ein unzureichendes Hilfsmittel, und sie ist das einzige Hilfsmittel. Ein schönes Dilemma.“ (S. 131)
Diesem Dilemma ist Bernhard Strobel mehr als gewachsen. Seine Sprache vermag viel, sehr viel sogar. Sie löst ein, was gute Literatur können sollte: über eine bisweilen beunruhigende Selbstbefragung zu mehr Klarheit über sich selbst und die Welt zu gelangen.
Herbert Först
Textprobe:
„Sie saßen nicht mehr am Tisch; sie waren inzwischen aufgestanden und schlenderten durch den Garten. Er ging zu ihnen hin. Sie standen vor dem kleinen Gemüsebeet und redeten laut, unkontrolliert laut, das Ganze wirkte rücksichtslos und störend, in der ganzen Nachbarschaft war sonst kein Ton zu hören. Er dachte: Es scheint sie einen Dreck zu interessieren, dass ich zurück bin. Er wartete auf ein Zeichen von Aggression, ein Bedürfnis, sich Luft zu machen, aber es kam nichts; was er stattdessen empfand, war Verwunderung, es grenzte an Fassungslosigkeit. Erst jetzt fiel ihm auf, dass unter den Bademänteln viel nackte Haut zu erkennen war, offenbar trugen sie darunter immer noch ihre Badesachen, und er sah, dass einer der Mäntel ihm gehörte. Und als er noch ein wenig genauer hinsah, in einem Moment, als Karina sich nach vorn beugte, um eine der großen Fleischtomaten zu pflücken, entdeckte er, dass sie kein Oberteil trug. Er blieb abrupt stehen. Er dachte: Hat sie untenrum etwa auch nichts an? Doch, das hatte sie, und obgleich er der Meinung war, dass er jedes Recht hatte, gemeinsam mit Karina auch ihre Freundin anzuklagen, schreckte er dennoch davor zurück, sie ebenfalls genauer ins Auge zu fassen. Ich will es nicht wissen, ich will es gar nicht wissen, dachte er, aber ehe er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, wusste er es schon. In dieser Sekunde erst machte sich ein Anflug von Wut bemerkbar, ein weniger überzeugender Anflug jedoch, da sich durch den Anblick der beiden Frauen im Bademantel und die Vorstellung, wie sie darunter aussahen, eine leise aufwallende Erregung hinzumischte, er merkte, wie die aggressive Anwandlung immer mehr unterdrückt wurde, bis sie sich kurz darauf ganz legte und er versöhnlich, beinahe fröhlich gestimmt war, es war, als ob ein dichter, dunkler Nebel sich plötzlich lichtete. Doch als er gleich darauf sah, wie Karina sich benahm, und was sie dann sagte, lenkte das seine Gedanken schlagartig in ihre ursprünglichen Bahnen.
Sie befanden sich noch immer beim Beet. Karina hatte sich die Badeschuhe ausgezogen und stand mit einem Fuß in der Erde, pflückte die größte Fleischtomate, die sie finden konnte, und reichte sie hinaus, und als die Freundin mit einem erstaunten Gesichtsausdruck und viel zu lauter Stimme rief: ‚Du meine Güte, was sind das für Tomaten!‘, antwortete Karina: ‚Es ist der Samen von meinem Mann.‘ Sie kicherten. ‚Der Samen von deinem Mann?‘, fragte die Freundin. ‚Ein ganz besonderer Samen‘, sagte Karina, worauf das Kichern in einen Lachanfall überging, sie kreischten, wieherten und mussten sich mit den Armen auf den Oberschenkeln abstützen.
Er war fassungslos. Er konnte nicht begreifen, was eben geschehen war. Eine dunkle Tiefe höhlte sich in ihm aus, und sein Mund war von einer Sekunde auf die andere wie ausgetrocknet.“ (S. 51f.)
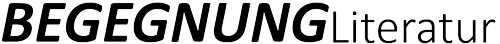
Kommentare sind deaktiviert