„Das weite Land“ –
Arthur Schnitzlers Spiel von der „allgemeinen Überforderung im Dasein“
Eine Nachlese zu einem Besuch an der Kunstuniversität Linz
Als „Das weite Land“ am 14. Oktober 1911 am Burgtheater und an acht weiteren deutschsprachigen Bühnen uraufgeführt wird, spürt der seinem Wesen nach höchst selbstkritische Autor Arthur Schnitzler, dass ihm mit seiner Tragikomödie ein Theaterstück von bleibender Wirkung gelungen ist. Auf seinen durchschlagenden Bühnenerfolg Bezug nehmend vermerkt er vier Jahre später in seinem Tagebuch: „Hier bin ich etwas mehr als ein Künstler.“1) Was den ausgebildeten Mediziner Arthur Schnitzler mit seinem zweiten Beruf verbindet, ist die Gewohnheit, seinen scharfen Blick auf die Welt mit einer Diagnose zu erhellen. Sein kongenialer Zeitgenosse Sigmund Freud bestätigt ihm in seinem legendären Geburtstagsbrief vom 14. Mai 1922 die analytische Grundhaltung eines „psychologischen Tiefenforschers“2), der über Intuition und Selbstwahrnehmung zu seinen Befunden gelangt.
Freuds Kompliment führt zur Frage, was der „Tiefenforscher Schnitzler“ in seinem Theaterstück zutage fördert. Etwas mehr als 100 Jahre nach der Uraufführung stellt eine Studentin an der Kunstuniversität Linz lapidar fest: „Das Weite Land“ sei Ausdruck der „allgemeinen Überforderung im Dasein“. Eine starke Diagnose, in ihrer kühnen Klarheit verlockend genug, ihr nachzugehen und sie zu überprüfen.
Die Fabel – zeitgebunden, eine Ehebruchsgeschichte in einer großbürgerlichen Familie der Jahrhundertwende: Der Glühbirnenfabrikant Friedrich Hofreiter und seine Frau Genia haben einander in ihrer Ehe verloren. Ohne viel zu überlegen, es als sein Recht betrachtend, stürzt Friedrich sich in die nächste Liebschaft, eine leidenschaftliche Affäre mit der um vieles jüngeren Erna, wohl wissend, dass er damit seinen Freund Doktor Mauer aufs tiefste verletzt, da dieser Erna voll Hoffnung verehrt. Als Genia dem Werben des Fähnrichs Otto nachgibt, schlägt das erotische Spiel der Eheleute in tödlichen Ernst um, der Kreisel von Eros und Thanatos beginnt sich schwindelerregend zu drehen.3) Friedrich, der alternde Liebhaber, provoziert Otto zu einem Duell, in dem er diesen erschießt.4) Mit ihm löscht er auch die Jugend aus, die für ihn unwiederbringlich verloren ist. Zurück bleiben Menschen, die in Einsamkeit erstarren.
Markant ergiebig – die Schlussszene: Eben hat Friedrich Hofreiter die auf eine gemeinsame Zukunft hoffende Erna zurückgestoßen, ihr kalt zu verstehen gegeben, dass er niemandem gehöre, als im Garten der weitläufigen Badener Villa die Stimme eines Kindes zu hören ist: „Vater! Mutter!“ Percy, Friedrichs und Genias Sohn, der in England erzogen wird, ist eingetroffen und freut sich auf gemeinsame Wochen mit seinen Eltern. Da durchfährt es den Vater, was er zerstört hat. „Er wimmert einmal leise auf“5), merkt die Bühnenanweisung an.
Mit dem Namen Percy, einer Kurzform zu Parzival, eröffnet Arthur Schnitzler einen reichen motivischen Kontext: Parzival – das ist der durch das Tal Ziehende, der nach einem verheißenen Glück Suchende, der vaterlose Jüngling, der rein ins Leben aufbricht und dabei seine Mutter verliert. Als Percy in unbändiger Vorfreude seine Eltern ruft, betritt er ein nur noch scheinbar intaktes Gebäude; in dessen Räumen erwartet ihn die Wüste einer zerstörten Welt.
In diesem Schlussbild zeigt sich des Autors prophetischer Blick: Fünf Jahre nach der Entstehung des „Weiten Landes“ stürzt Europa in den Abgrund eines barbarischen Krieges. Percys Generation wird eine verlorene sein, eine ohne Väter und Mütter; eine, deren Suche nach einem verheißenen Glück in die Schlachten des Weltkrieges und die quälende Not der zwanziger Jahre führen wird. Im Zerfall der Familie Hofreiter nimmt der Autor Schnitzler das Ende seiner Welt vorweg, und einiges spricht dafür, dass der Arzt Schnitzler in diesem Drama tatsächlich unser aller „Überforderung im Dasein“ diagnostiziert. Für sie gilt es Belege aufzuspüren.
Im Binnenkosmos der Villa Hofreiter bestimmen Täuschung und Selbsttäuschung, Konvention und Pose das gesellschaftliche Spiel. Nur selten wird an der Oberfläche – in Sprache oder Gestik – das Lebensgefühl der Figuren unmittelbar greifbar. Friedrich, der erfolgreiche Unternehmer, gibt die (Spiel-)regeln vor, nach denen sich seine Welt zu richten hat. Seiner Frau Genia gegenüber deutet er an, woran er, der unwiderstehliche Bonvivant, sich in seinen Liebschaften und Affären hält. Angesichts des Selbstmords des jungen Pianisten Korsakow, dessen Begehren Genia standhaft nicht nachgegeben hat, sagt er, dass die von seiner Frau ernstgenommene Treue „in Wirklichkeit gar nichts“ sei, „ein Schemen, ein Phantom, ein Nichts“; schlimmer noch: Genia sei ihm unheimlich geworden, weil ihre „Tugend einen Menschen in den Tod getrieben“6) habe. Indem er jene ethische Norm, die Genia Halt und Orientierung gibt, außer Kraft setzt, sie sogar in ihr Gegenteil verkehrt, entzieht er seiner Frau den Boden unten den Füßen;7) aus dem Lot gefallen findet sie sich fortan „in ihrem Leben nicht mehr zurecht“8). Damit öffnet Friedrich jenen Kräften Tür und Tor, die in letzter Konsequenz den Zerfall der Familie herbeiführen.
Das Verhältnis müsse endgültig klargestellt werden, ruft Friedrich vor der Tennispartie9) mit dem Fähnrich Otto und vergreift sich damit folgenschwer am Leben, das im schillernden Bereich menschlicher Beziehungen klare Verhältnisse nicht kennt, nicht kennen kann: Das Natürliche sei das Chaos, die Ordnung nur etwas Künstliches – so der Vater des Fähnrichs im dritten Akt10) und – mehr als naheliegend – vielleicht auch die Stimme des Autors. Friedrich aber verschließt sich dem, was wohlmeinende Menschen ihm sagen wollen, ist entschlossen, die angekündigte „Klarstellung“ auf kürzestem Weg herbeizuführen: mit der Gewalt eines Pistolenduells.
Friedrich Hofreiters finales Bekenntnis, dass er niemandem auf der Welt gehöre11), kann nach allem, was in den fünf Akten offenbar geworden ist, als Ausdruck konsequenter Asozialität gesehen werden. Er nimmt sich von jedem, was er braucht, gesteht anderen diese „Freiheit“ nicht zu und kümmert sich „um das, was sonst in dem Menschen stecken mag, kaum“12). So reduziert er Liebe zum unverbindlichen Spiel, dem das Gefühl von Verantwortung für andere fremd ist.
Menschen vom Schlage Friedrich Hofreiters hat Arthur Schnitzler möglicherweise vor Augen, wenn er in einem Aphorismus illusionslos resümiert: „Das muss schon ein Mensch von hoher Art sein, dem die Sehnsucht nach Freiheit etwas anderes bedeutet als die Begier nach Verantwortungslosigkeit.“13) Darin verbirgt sich ein ethischer Anspruch, der aufhorchen und nachdenken lässt; er war vielleicht gemeint, als jene Studierende an der Kunstuniversität Linz von der „allgemeinen Überforderung im Dasein“ sprach.
Herbert Först
Anmerkungen:
- „Arthur Schnitzler Tagebuch“, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1981
- Sigmund Freud: Brief an Arthur Schnitzler vom 14. Mai 1922 (Zitiert nach: Die Wiener Moderne, Verlag Reclam, S. 651ff.)
- Kunstprojekt LOVE GAME (11), Melanie Ludwig: Korsakows Brief, Folien auf Glas
- Kunstprojekt LOVE GAME (1), Martin Bischof und Andreas Tanzer: Ins weite Land, 3 Holzobjekte, bemalt
- Schnitzler, Arthur: Liebelei und andere Bühnenwerke, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 451. – Vergl. Kunstprojekt LOVE GAME (13), Julia Zöhrer: Das weite Land, Buch
- Schnitzler, Arthur: Liebelei und andere Bühnenwerke, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 392
- Kunstprojekt LOVE GAME (5), Judith Gattermayr: Genias Kleid, Stoffobjekt, bedruckt
- Schnitzler, Arthur: Liebelei und andere Bühnenwerke, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 443. – Vergl. Kunstprojekt LOVE GAME (7), Julia Gutweniger: Ich finde mich nämlich nicht mehr zurecht, Briefe, gerahmt
- Kunstprojekt LOVE GAME (8): Katharina Kaff: Smash, Betonobjekt, bemalt
- Schnitzler, Arthur: Liebelei und andere Bühnenwerke, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 412
- Kunstobjekt LOVE GAME (10): Jakob Lechner: Friedrichs Manifest, Folien auf Glas
- Schnitzler, Arthur: Liebelei und andere Bühnenwerke, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 351
- Schnitzler, Arthur: Buch der Sprüche und Bedenken. Aphorismen und Fragmente, Phaidon-Verlag, Wien 1927
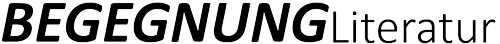
Kommentare sind deaktiviert