„Manchmal übernehmen die Umstände das Leben.“
„Wald“ – Doris Knechts Romanstudie über das „Wegrutschen – Abgleiten – Fallen“
Was tun, wenn ohne ersichtliches Verschulden der Boden der Lebensexistenz wegbricht und Leben zum Kampf ums Überleben wird? Dieser Frage geht Doris Knecht in ihrem bislang dritten Roman nach. Sie gibt ihm den Titel „Wald“ und lässt in ihm eine Frau in eine solche Existenzkrise fallen. Wie Marian – so der Name der Heldin – ihr begegnet und sie letztlich bewältigt, davon erzählen 271 packende Seiten. Sie geben schonungslos Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt dieser Frau, deren wirtschaftlicher Absturz in Europa längst kein Einzelschicksal mehr ist. Das zu lesen geht unter die Haut, entspricht Franz Kafkas Überlegung aus dem Jahre 1904, man „sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen“.
„Sie schaut auf die steifen Haare auf ihren Armen und die von Kälte aufgeraute Haut, lässt ihren Blick auf diesen Armen ruhen (…) Sie schiebt die Decke ein Stück von sich, legt ihre Arme darauf und spürt ihrem mageren Körper nach. Der letzte Winter ist daran schuld, ihr erster Winter. Der Horrorwinter. Sie wird diesen Winter nie vergessen. “
Quälende Kälte nach dem Erwachen – für Marian ein Tagesanbruch wie viele andere auch in der Einöde eines alten Gehöfts, wo ihr Leben darauf reduziert ist, „Mittel und Wege zu finden, um zu überleben“ (Doris Knecht in ihrem „Standard“-Interview vom 28. Februar 2015). Was folgt, ist ein detailliert dokumentierter Bericht über den Verlauf eines Tages, durchsetzt von Erinnerungen an ihr Leben als erfolgreiche Modedesignerin und an den von der Finanzkrise 2008 ausgelösten Sturz ins materielle Nichts. Marianne ist über vierzig, eine Frau von Disziplin, Ehrgeiz und Tatkraft:
„Damals konnte sie ja alles alleine. Sie konnte ihr Leben alleine auf die Reihe kriegen, sie konnte ihr Geschäft alleine aufbauen, sie konnte es alleine organisieren und verwalten, sie brauchte ja keine Hilfe, von niemandem, sie war eine wache, autonome, intelligente, gut organisierte, selbständige, kreative Selfmade-Frau in jeder Hinsicht.“ (S. 58f.)
Die Wirtschaftskrise hat sie doppelt getroffen: Das Atelier ist ihr abhandengekommen, und das Beziehungsgeflecht, in dem sie sich bisher bewegt hat, hat sich aufgelöst. Geblieben sind ihr eine erwachsene Tochter, die in London lebt, und ein brüchiges Haus in der Einschicht, das sie von einer Tante geerbt hat. Aus dem mondänen Leben der pulsierenden Stadt gefallen, ist sie nun an einem Ort gelandet, „an dem nur sie bestimmte und an dem nur ihr Wort galt, weil kein anderes zu hören war“ (S. 231).
Marians Charakterstruktur lässt es nicht zu, sich aufzugeben; sie beginnt sich als Selbstversorgerin einzurichten, nimmt den Überlebenskampf auf. Erinnerungen an „Robinson Crusoe“ und „Die Wand“ kommen hoch, doch jene exemplarischen Berichte über ein Überleben in Abgeschiedenheit unterscheiden sich in einem Punkt wesentlich von Doris Knechts Roman: Marian muss sich nicht nur der Lebensbewältigung stellen, sondern auch den weitgehend feindseligen Menschen des nahen Dorfes. Und da ist dann noch Franz, mit dem sie etwas verbindet, das sie grundsätzlich die Beziehung der Geschlechter analysieren lässt.
Der Einheit von Zeit und Ort folgend gibt Doris Knecht ihrem Roman eine strenge Struktur. Über die 22 nicht nummerierten Kapitel legt sie den zeitlichen Rahmen eines Tages:
„Das Geräusch ist winzig. Ein Klicken nur, minimal, gar nicht laut, von irgendwo unten, und sie wird davon wach. Rutscht schnell aus dem Schlaf heraus, aus einem Traum, lauscht: nicht ängstlich, lauernd – aber da ist kein Geräusch mehr. Es ist still. Finster und sehr still.“ (S. 7)
Dieses „Herausrutschen aus einem Traum“ eröffnet einen Erzählfluss, dessen Spannungsbogen das Geschehen eines einzigen Tages zusammenhält, wobei ein bemerkenswert subtiler Kunstgriff Anfang und Ende dieses Bogens verbindet. Die durchgehend eingehaltene personale Erzählperspektive erlaubt es, die erzählte Zeit gewaltig auszudehnen: In Marians Gedanken gibt es keine Grenze zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem:
„Sie hat keine Angst. Vor merkwürdigen Geräuschen in der Nacht hat sie schon lange keine Angst mehr. Angst hatte sie früher, als sie noch mit Oliver zusammen war (…), eine mysteriöse, ja bizarre Überängstlichkeit war ihr damals immanent gewesen, unerklärlich hinter den drei Luxusschlössern ihrer stahltürverstärkten Wohnung, in der sie nicht schlafen konnte, wenn Oliver nicht da war, in der sie wach lag und ihren massierten, epilierten, gecremten Körper in seiner Biobaumwollhülle herumwälzte.“ (S. 7)
Dieser schon auf der ersten Seite als Grundakkord angeschlagene Kontrast zwischen der bitter kargen Existenz in der Gegenwart und dem verlorengegangenen Leben in Luxus bestimmt fortan den Text, sowohl atmosphärisch als auch thematisch, und er lässt Marian immer wieder darüber nachdenken, was der Mensch letztlich zum Leben braucht:
„Sie braucht nicht mehr so viel, seit diesem Winter, dieser Winter hat ihr gezeigt, mit wie wenig man überleben kann. Sie wusste nicht, dass das geht. Jetzt weiß sie es, und manchmal denkt sie, dass sie genau deswegen hierherkommen ist: weil sie das wissen wollte oder vielleicht in ihrem Innersten schon wusste. Dass man gar nicht so viel braucht zum Überleben.“ (S.35)
Parallel dazu zwingt die neue Lebenssituation Marian, sich Fertigkeiten anzueignen, die ihr in ihrem früheren Leben fremd waren: Sie näht, backt Brot, baut Gemüse an, fischt, wildert und stiehlt Hühner. Folgerichtig meint die Autorin in ihrem Standard-Interview, dass sie es richtig finde, „dass man die Sachen, die man isst, auch selber töten können sollte“, weil dieses Konzept dazu führen würde, „anständiger zu leben und weniger Schaden anzurichten“. Indem Doris Knecht erzählend diese Idee ausarbeitet, diskutiert sie die brennend aktuelle Frage, wie zukunftsfähig die Lebensweise der Wohlstandswelt ist.
Ähnlich brisant auch die Auseinandersetzung mit den Koordinaten der Beziehung von Mann und Frau. Ernüchternde Erfahrungen mit Bruno und Oliver liegen hinter ihr. Nun, in der Einsamkeit ihrer radikal reduzierten Existenz, begegnet sie Franz, einem gutsituierten, einflussreichen Gutsbesitzer.
„Sie war unvorstellbar hungrig, in jeder Hinsicht. Und das war ihr schon auch bewusst, das war ihr klar, dass es hier in erster Linie darum ging, satt zu werden, und sie dachte in diesen ersten Wochen mit Franz viel nach. Über Abhängigkeiten und Verträge, über Selbstaufgabe, über den Preis eines Menschen und darüber, was man so wert war. Was sie so wert war. Wie viel sie bereit war zu zahlen und in welcher Währung.“ (S. 203f.)
Schon ihr erstes Zusammentreffen definiert die kommende Beziehung: Franz überrascht sie beim Wildern. Dergestalt in Abhängigkeit geraten lässt sie sich – intuitiv wie ein „folgsames Mädchen“ (S. 143) reagierend – auf ihn ein und wird seine Geliebte, natürlich nicht unbemerkt von der Dorfgemeinschaft. Das Wort „Hur“ – an jenem Tag weithin sichtbar an die Eingangstür geschmiert – führt Marian zu einer illusionslosen Analyse darüber, was das Miteinander oder – vielleicht besser – das Gegenüber von Mann und Frau ausmacht:
„Die Gründe, wieso Frauen mit Männern schliefen und Männer mit Frauen, waren überaus vielfältig, und genauso vielfältig waren die Gründe, wieso sie überhaupt Beziehungen hatten. Jede Beziehung war ökonomisch, wurde es zumindest irgendwann. Romantische Liebe oder auch nur liebevolle Zuneigung war vermutlich einer der selteneren Gründe. Oder auch nicht selten, so als Anfangsimpuls, als Initiationsritus sozusagen durchaus zündend; aber meistens schliefen die Leute doch auch dann weiter miteinander, wenn sich das abgenutzt hatte – und es nutzte sich immer ab, zuverlässig. Und wurde ersetzt durch andere Argumente, von denen die meisten vermutlich nicht hehrer waren als Marians.“ (S. 212)
Als Franz ihr am Abend dieses Tages vorschlägt, sie, die ehemals erfolgreiche Unternehmerin, möge doch seinem Sohn bei der Wiedereröffnung des Dorfgasthauses beratend zur Seite stehen, spricht so manches dafür, dass Marian vor der nächsten Wende ihres Lebens steht:
„Es ist nach elf, sie ist normalerweise längst im Bett um diese Zeit, aber jetzt geht sie noch einmal nach draußen, vor die Tür, mit Scheuermittel und einem Eimer, mit einem Schwamm und Stahlwolle, und dann schrubbt sie, bis es weg ist, das Hur.
Der Lack ist auch ab, aber egal.“ (S. 271)
Das liest sich gut, ist aber weit entfernt von einem billigen Happy End, unterlegt vielmehr den Text mit der Zuversicht, dass Lebenskrisen bewältigt werden können und neue Räume öffnen. Dass diese Botschaft glaubwürdig ankommt und „Wald“ ein authentisches literarisches Dokument unserer Zeit wird, dafür sorgt der einzigartige Erzählton, den Doris Knecht für ihre Marian gefunden hat. Er gibt dieser starken Frau jene Lebendigkeit und Frische, die eine Kunstfigur braucht, um zu überzeugen.
Textprobe:
„Dann bindet sie die Haare mit dem stets am Handgelenk sitzenden Haargummi hoch und fängt sofort an, das Holz in den Schubkarren zu laden, es zum Haus zu fahren und unter dem breiten Vordach rechts neben der Haustür und ihren sieben Stufen aufzustapeln, bevor es feucht werden kann. Das Holz ist gut. Das Holz vertreibt viele Sorgen. Das Holz ist ein Segen, jedes Scheit, das sie an der Ostwand unter das schmale Vordach stapelt, macht ihr Leben leichter, und immer zählt sie die Scheite mit, die sie aufstapelt, immer höher stapelt, gut ineinander verkeilt. Ihr erster, mannshoher Stapel war ihr umgefallen, als sie sich umgedreht hatte, um weitere Scheite aus dem Schubkarren zu holen. Eins der schweren Hartholztrümmer hatte sie dumm am Kopf getroffen und ihr hinter dem rechten Ohr die Kopfhaut aufgerissen, es blutete lange und beängstigend. Sie hatte es dann selber mit Pflaster zugeklebt, vor dem Spiegel, der ihr fast nichts von der Stelle zeigt, sosehr sie sich auch verdrehte und ihre Augen anstrengte, und es wurde eine hässliche und noch immer taube, aber für sie selbst unsichtbare und unter ihrem Haar kaum erkennbare Narbe, die ihr nur einfällt, wenn Franz sie zufällig berührt. Das gestapelte Holz ist ihr nie wieder umgefallen, sie hat die Technik jetzt raus. Man darf das Holz nicht schon in der ersten Lage zu dicht an die Wand stapeln, dann fällt es um. Man muss die ersten Scheite ein wenig von der Wand weg stapeln und die folgenden langsam auf die Wand zu hinrichten, man muss die Holzscheite ineinander verkeilen, und während man stapelt, muss man immer und immer wieder an der wachsenden Holzwand rütteln, um ihre Festigkeit und Standhaftigkeit zu prüfen. Nach der fünften oder achten Wand, nach dem achten oder zehnten Kubikmeter Holz geht einem das in Fleisch und Blut über, in ihre Hände. Ihre Hände wissen jetzt, wie es geht, das Wissen, wie ein Holzstoß stehen bleibt, nicht umkippen kann, ist ihr ins Blut übergegangen, wie das Säen von Grassamen (über Kreuz) oder das Stricken oder das Jäten. Ihre Hände können das jetzt, so wie sie früher zuschneiden konnten, abstecken, fälteln, umnähen. Ihre Hände keilen schmale Holzscheite jetzt von selber in die Lücken zwischen große, und sie passt auf, dass sie den Holzstoß an seinem Fuß immer etwas von der Wand entfernt ansetzt, damit er sich später an die Wand lehnen kann. Obwohl sie schon lange nicht mehr direkt am Boden zu stapeln und schlichten hat beginnen müssen. Das neue Holz kommt jetzt immer, lange bevor das alte Holz zu Ende ist. Es ist jetzt immer Holz da. Franz hat ein Auge darauf. Er kümmert sich. Sie macht die Ofentür noch einmal auf, nur um die Hitze zu spüren, nur um zu sehen, wie es lodert, und es lodert schön.“ (S. 120 ff.)
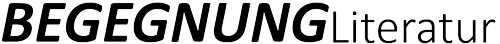
Kommentare sind deaktiviert