„In Afrika will ich die Welt wiederfinden.“ (S.93)
Thomas Stangls Roman „Fremde Verwandtschaften“
kann als epische Meditation über den Turmbau zu Babel gelesen werden.
Mit „Fremde Verwandtschaften“ kehrt Thomas Stangl zurück in die Welt seines ersten Romans „Der einzige Ort“: nach Afrika. Schauplatz diesmal: Senegal mit seiner Hauptstadt Dakar, die den vielsagenden Namen Belleville bekommt.
Im Titel verbirgt sich das thematische Zentrum des Textes: das Sich-Fremd-Werden eines Menschen, der sich – die Eckdaten seines Lebens in Europa betrachtet – auf festem Boden zu bewegen scheint, doch schon der erste Satz wartet mit einer irritierenden Überraschung auf:
„Im September 1911 fährt Franz Kafka zum ersten Mal mit der Metro; er beschreibt dieses Erlebnis ausführlich in seinen Reisetagebüchern. Ein Satz in dieser Beschreibung lautet: ‚Man ist auch nicht weit von den Menschen, sondern eine städtische Einrichtung, wie z. B. das Wasser in den Leitungen‘. Ich schrieb diesen Satz, als ich ihn in einem Hotelzimmer in Paris, nah der Place de la République, las, gleich in mein Notizbuch ab.“ (S.5)
Dieser Einstieg und der folgende Absatz haben es an sich, LeserInnen zu verunsichern, sie davor zu warnen, sich auf einen leicht durchschaubar erzählten Roman zu einzustellen: Zwei Erzählperspektiven führen zu zwei verschiedenen Orten: Da befindet sich ein Ich-Erzähler in einem Hotel in Paris, und einige Zeilen später steht ein Familienvater – er wird „der Architekt“ oder „dieser Architekt“ (S.5) genannt – vor seiner Abreise nach Afrika zu einem Kongress in der Hauptstadt des Senegal. Er, ein Mittvierziger, „der aus seiner Angst nicht herauswill und es sich gut eingerichtet hat mit seinen Gespenstern“ (S.151), ein klassischer Antiheld, blickt an diesem Morgen aus dem Fenster und sinniert über seine Beziehung zur Welt:
„Er erinnert sich, dass er als Kind oder eher als Jugendlicher in seinem Atlas auf der Europakarte die Städte bunt gekennzeichnet hatte, in denen er bereits gewesen war, dann ein Netz zwischen diesen Städten gezogen: als würde in dem Muster etwas zu erkennen sein, etwas, das ihn betraf und zugleich die Welt.“ (S.6)
Was die beiden Figuren verbindet, das ist der Blick aus dem Fenster. Er wird zu einem bestimmenden Motiv des Romans, der in neun Kapiteln von des Architekten Ringen um Selbstfindung und Orientierung erzählt.
Der Architekt – im Verlauf des Geschehens bekommt er den Namen Harald Hiesl – soll bei diesem Kongress Pläne für ein Studentenheim an der Universität von Belleville präsentieren, doch der Zweck der Reise tritt schon bald in den Hintergrund, verliert sich in den Aktivitäten der Kongressgesellschaft und im Wirrwarr der Stadt. Er, der auf „Lebendigkeit, Unvorhersehbares“ (S.26) aus ist, hat berufsbedingt schon viel über Städte nachgedacht:
„Eine Stadt braucht Zonen des Übergangs; sie braucht eine unkontrollierbar scheinende Unterwelt. Transparente, bis ins Einzelne geplante Städte, Orte ohne Geschichte, ohne (in welchem Sinn auch immer) dunkle Regionen sind, wie man weiß, trostlos und leblos (solange nicht gerade die Verlassenheit und eisige Oberflächlichkeit zur Haut wird und etwas Neues, Ungeplantes, eine Art von Geheimnis entsteht).“ S.24
Die westafrikanische Metropole kommt ihm da gerade recht. Schon bald öffnen sich die „dunklen Regionen“ der Stadt am Meer, sei es bei Erkundigungen mit „der Belgierin“ oder allein.
An Koordinaten im Netz der Persönlichkeit des Architekten sind zu nennen: eine übermächtige Beziehung zum Vater; der Wunsch, ein guter Vater seinen beiden Kindern und ein verlässlicher Partner seiner Frau Margarita zu sein; eine beharrliche Suche nach Sinn („Ich bin ein Architekt, aber es geht um etwas anderes.“ S.96); eine stets erotisch erlebte Nähe zu Frauen und schließlich eine tief sitzende Unsicherheit:
- „Vielleicht täuscht sich Margarita, es gibt für ihn nicht die Welt, es gibt nur die Wiederholung; und das, was sie für die Welt hält, ist nur die Wiederholung einer Wiederholung, weil er nichts ist als der Sohn seines Vaters.“ (S.96)
- „Er kann nicht an ein wirkliches Leben glauben.“ (S.138)
- „Mit jedem Schritt kann er einen Punkt betreten, auf dem der Boden unsicher wird.“ (S.170 )
In der Rolle eines distanzierten Beobachters lässt der Architekt das Programm des Kongresses über sich ergehen; was ihn zunächst noch an die Gruppe bindet, das ist „der zarte glatte weiße Nacken“ (S.34) der Belgierin Sophie, mit der ihn eine etwa drei Jahre zurückliegende Affäre in Paris verbindet und die ihm flüsternd gesteht:
„Ich möchte dieses dunkle Kästchen in dir aufmachen und rauslassen, was drin eingesperrt ist.“ (S.127)
Diesmal lässt er sich aber nicht mehr mit ihr ein; er zieht eine nächtliche Odyssee durch die Straßen der Stadt, deren „geträumte Unterseite“ (S.139) er kennenlernen will, einem weiteren Abenteuer vor.
Zweimal ist der Architekt allein im „Babel“ (dt. Wirrsal) von Belleville unterwegs, bewegt sich durch das sich verästelnde Netz der Straßen und Plätze, „hält Ausschau nach geheimen Wegen“ (S.153), nähert sich dem Meer, wo „die Stadt abbricht“ (S.204). Vorbereitet werden diese „Erkundungen“ im Kapitel 3 in einem ausführlichen Exkurs über den biblischen Turmbau zu Babel (Gen. 11) und das entsprechende Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren:
„Er hat sich angewöhnt, nicht nur auf Reisen, sondern auch in seiner Heimatstadt ab und zu ohne den Anlass einer besonderen Ausstellung ins Museum zu gehen und landet dort jedes Mal vor dem eigentlich doch tödlich berühmten Bild vom Turmbau zu Babel.“ (S.97)
In diesem Bild findet er seine Wahrnehmung der Welt dramatisch verdichtet.
„Was den Architekten fasziniert, ist weniger das Bild selbst als das, was darin nicht zu sehen ist, worauf aber die vielen Eingänge, die vielen dunklen Fenster, die kleinen, leicht zu übersehenden Gestalten verweisen. Was ist im Innern dieses Dings; wartet hier schon etwas? Eine Welt anstelle der Welt? (…) Es gibt Tunneleingänge, durch die vielleicht nicht nur einzelne Arbeiter oder Bewohner, sondern auch Wagen, Pferde, Reiter, wie sie auf den Plattformen zu sehen sind, hinein ins Dunkle gelangen, ins Dunkle hineingesaugt werden können. (…) Wo die Fassade oben geöffnet ist, ist der Bau rötlich, als wäre es ein Wesen aus Fleisch und Blut und man hätte hier den Blick auf die Schicht der Muskeln oder Eingeweide. (…) Der Architekt stellt sich ein pumpendes Herz vor, er stellt sich Wunden vor, er stellt sich das Aussetzen dieses Herzens vor. Dann erkaltet der Stein; dann ist er erkaltet.“ (S.97f.)
Der Keim für dieses System von unterirdischen Röhren und Gängen wird bereits im ersten Satz des Romans gelegt: in der eingangs zitierten Reisetagebucheintragung Franz Kafkas. Sie verweist motivisch auf die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel, in der Gott herabsteigt und auf den Hochmut der Menschen mit der Verwirrung der Sprachen und der Zerstreuung der Menschen über die ganze Erde reagiert – für den Architekten eine groß angelegte Metapher für die Verlorenheit und Orientierungslosigkeit des Menschen, die nach einem Traumkapitel in den Kapiteln 7 – 9 erzählerisch nachvollziehbar gemacht werden soll. Doch dieser Herausforderung ist der Autor nur bedingt gewachsen. Die bis dahin durchaus stringent erzählte Geschichte verliert sich zunehmend und entspricht der folgenden Beobachtung:
„Ich bin jetzt ganz im Innern der Stadt, es gibt keine Öffnung, keinen freien Platz, nicht einmal einen Himmel über dem Kopf, in den man aufflattern könnte. Tief im Innern des Baus krabbeln wir übereinander wie die Insekten. (…) Wenn die Stadt sich immer in sich hineindreht, komme ich doch nie heraus.“ (S.215)
Ich-Erzähler und Architekt sind längst eins geworden, bevor nach einer verstörend seltsamen Autofahrt im letzten Kapitel so manches wieder gebündelt wird und der Kongress zu Ende geht. Am Tag der Abreise fällt der Architekt im Transitbereich des Flughafens, aus dem es „keinen Weg zurück und offenbar auch keinen Weg vorwärts gibt“ (S.263), abermals in einen Traum, mit dem der Roman ausklingt:
„Er ist nackt, und es gibt keine Wände. (…) Er sitzt in der Ecke, sehr friedlich, kaum sichtbar (vom Innern des Spiels aus) und schaut zu. (S.271)
Angemerkt sei noch, dass Thomas Stangl seine Studie über den Zerfall eines Lebensentwurfs – „es war ein Fehler hierherzukommen“ (S.214) – mit Fragen der Wirklichkeit, der Architektur, des Kapitalismus und zwangsläufig mit Fragen des Kolonialismus und der schwierigen Beziehung zwischen Europa und Afrika verknüpft. Fordernd an dem sprachlich eher schlicht gehaltenen Text sind die vielen, mitunter nicht notwendig erscheinenden Klammerausdrücke sowie hin und wieder Sätze, die einer Sinnprüfung nicht standhalten.
Afrika, jenen Kontinent, von wo der Homo Sapiens aufbrach um den Planeten zu bevölkern, als Schauplatz einer Sinnsuche und Expedition in das „heart of darkness“ zu wählen, ist ohne Zweifel ein bemerkenswerter Ansatz für einen Roman; im Falle der „Fremden Verwandtschaften“ ist der epische Atem aber etwas zu kurz geraten.
Herbert Först
Textprobe:
Der Architekt erscheint sich selbst blass, wie überbelichtet, er könnte noch in der Bewegung des Aus-dem-Bus-Steigens gleich in der Leinwand der Landschaft verschwinden. Unterstände mit graubraunen Matten und Strohdächern, graubraune Erde mit ein paar Schlammpfützen darin. Die Hitze ist drückend, aber hier muss es erst vor kurzem geregnet haben, hier und nirgendwo sonst auf der Strecke. Wie hässlich sind diese Weißen, denkt er, mit Blick auf seine unsicher herumstehenden Reisegenossen, wie absurd ist diese käsige Hautfarbe. Bei den Männern sowieso, aber selbst bei den Frauen. Die Einheimischen stehen genauso unsicher herum, jedenfalls die meisten Erwachsenen, eine Frau zetert vor sich hin und schubst ab und zu den Dekan an, der verlegen lacht und versucht, gleichzeitig den Kopf zu schütteln, ein paar Kinder klatschen rhythmisch in die Hände und beginnen zu tanzen. Einer der Besucher beginnt, die tanzenden Kinder zu filmen. Einige andere versuchen mit den in lange bunte Wickelröcke gekleideten Dorffrauen zu sprechen. Nicken, Lächeln, freundliche Gesten. Männer mit finsterem Blick, langsamen Bewegungen halten sich im Hintergrund, tun so, als wäre nichts, als wären die Besucher nicht da, als könnten sie mit einer Handbewegung alles wegwischen, Frieden würde einkehren. Es gibt gelbe Kanister unter einem Unterstand, in denen Benzin sein kann, Wasser oder sonst was, eine Ziege läuft durch den Bildhintergrund, Kinder und Tiere, damit kann man sich trösten und das Bild füllen, eine Ziege, ein weißes, ein rotes Huhn, für die Kinder Kinder und Tiere fotografieren, fremde Kinder für die Kinder daheim, vertraute Tiere aus der Fremde für die Kinder daheim. Fremde Wesen für die Kinder daheim. (…) Der Architekt empfindet das Fotografiertwerden wie einen Angriff und steckt seine Kamera wieder ein. Ohne die Kamera fühlt er sich allerdings nackt. (…) Warum dehnt sich die Zeit, so wie in den Nächten, nun auch tagsüber immer weiter aus, warum ist noch nicht Abend, warum sind sie nicht längst in Belleville. Der Architekt passt auf, nicht in die Pfützen zu treten. Nicht dazugehören, denkt er, weder schwarz noch weiß sein, wie gestern Abend, nur ein Körper. Eine Hand, die ihm übers Gesicht streift, das verschwitzte, feuchte, aufgequollene Gesicht, seine Hand, die über das Gesicht einer Frau streicht, einer fremden Frau. (S.172f.)
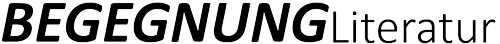
Kommentare sind deaktiviert